Von Marion Linhardt
Der deutschsprachige Raum des 19. und frühen 20. Jahrhunderts war durch eine immense Neu- und Umbautätigkeit im Bereich des Theaters gekennzeichnet. Sowohl Architekten und Baumeister mit breiter Expertise als auch stark spezialisierte Architekturbüros – das prominenteste ist wohl dasjenige von Ferdinand Fellner und Hermann Helmer – legten Entwürfe für Theaterbauten vor. Viele dieser Entwürfe blieben letztlich unrealisiert, sei es, weil sich das jeweilige Bauvorhaben gänzlich zerschlug, sei es, weil es sich um Beiträge zu Architektenwettbewerben handelte, aus denen dann ein anderer Entwurf als Sieger hervorging. Der Nachlass der Bühnentechniker-Dynastie Brandt gibt Aufschluss über einige Projekt gebliebene Theaterräume, die aufgrund ihres kulturpolitischen wie ästhetischen Gewichts besonders weitreichende Aufmerksamkeit erfuhren.
Am 14. Februar 1865 schrieb König Ludwig II. von Bayern an Richard Wagner über die gemeinsam gehegten Theaterpläne für München: „Was Semper’s Plan hinsichtlich eines provisorischen Theaters im Glaspalaste betrifft, so bin ich vollkommen damit einverstanden; nur brenne ich auch vor Verlangen, Semper’s Plan über unser, von Ihnen, mein geliebter Freund, wie von mir gleich ersehntes Fest=Theater endlich zu schauen, um den Vorgeschmack künftiger Wonnen schon jetzt zu empfinden!“1 Ein Theaterprojekt für die Hauptstadt des Deutschen Reichs kommentierte Hans Schliepmann in einer reich illustrierten Publikation, die 1913 als Sonderheft der Zeitschrift Berliner Architekturwelt erschien: „In der Voraussicht eines nötigen Neubaues [des Königlichen Opernhauses] an der alten Stelle hatte nun die Hofverwaltung schon 1896 das sogenannte Krollsche Etablissement am Königsplatz erworben und einen Umbau des alten Theaters, namentlich aber auch die Errichtung eines großen Bühnenhauses vorgenommen, um hier während der Bauarbeiten am neuen Hause Vorstellungen geben zu können. Als nun ein Neubau am Opernplatz sich als untunlich ergeben, richteten sich die nach einer geeigneteren Baustelle ausspähenden Blicke auf das Krollsche Gelände, dessen Besetzung mit einem dem Reichstagsgebäude an Monumentalität gleichkommenden Bau längst ein städtebaulicher Wunsch aller Kunstfreunde gewesen war.“2 König Ludwigs Brief und Schliepmanns architektonisch-städtebauliche Erläuterungen kreisen um vier ganz unterschiedliche Bauten für Theater als ein Ereignis, das Spielende und Schauende / Hörende zusammenführt: um den Einbau eines Theaters in den 1854 eröffneten Glaspalast in München, um das Vorhaben eines dem Werk Richard Wagners gewidmeten Festtheaters ebenfalls in München, um die Adaption des 1844 am stadtwärtigen Ende des Berliner Tiergartens eröffneten Etablissements Kroll als zweite Spielstätte der Königlichen Oper und um einen Neubau der Berliner Königlichen Oper, für den nach der Erwägung anderer Standorte schließlich jenes Terrain gewählt wurde, das seit 1864 den Namen Königsplatz trug und auf dem seit 1894, in der Symmetrie des Platzes gleichsam als Pendant zu Kroll, das neue Reichstagsgebäude dominierte. Von diesen Bauten gelangten das Theater im Glaspalast, das Münchner Festtheater und der Neubau der Königlichen Oper in Berlin über das Planungsstadium nicht hinaus, allein der Umbau von Kroll wurde realisiert.
Gallerie
Königsträume vor Bayreuth: Architektur für Wagners Festspiel
Carl Brandt und seinem Sohn Fritz kam in mehrerlei Weise eine wichtige Funktion für die Realisierung des Bühnenfestspielhauses in Bayreuth bzw. die ersten Aufführungen von Richard Wagners Der Ring des Nibelungen und Parsifal zu. Zwei bauliche Besonderheiten des Festspielhauses, der amphitheatralisch angelegte Zuschauerraum und der versenkte Orchestergraben – beides von Wagner bereits früh als wesentlich für sein Theaterkonzept formuliert –, waren auch für die von 1864 bis 1868 in München gehegten Pläne für ein Festspieltheater konstitutiv: Vermittelt durch Wagner und im Auftrag des für Wagner enthusiasmierten bayerischen Königs entwarf Gottfried Semper ein monumentales Theater, für das er einen Standort am Hochufer der Isar präferierte,3 und parallel dazu als Provisorium einen Theatereinbau in den ursprünglich als Veranstaltungsort für die Erste Allgemeine Deutsche Industrieausstellung errichteten Glaspalast im Botanischen Garten. Das Projekt des provisorischen Theaters scheiterte ebenso wie das Hauptprojekt nicht zuletzt aufgrund politischer Widerstände. Die Bestände im Nachlass Brandt dokumentieren unter anderem, welche Varianten der von Wagner gewünschten speziellen Form des Auditoriums Semper für das Theater im Glaspalast vorgelegt hat.
Die Materialien zum Festtheater, das der Aufführung des Ring des Nibelungen zur Vollkommenheit verhelfen sollte und für Ludwig II. zunehmend zu einem Sehnsuchtsort wurde, visualisieren neben der architekturhistorischen Relevanz des Projekts die Überlegungen Sempers zur raumkonstituierenden Funktion des Baus und zu dessen Potenzial, die Bedeutung Ludwigs als Herrscherpersönlichkeit wie als Förderer der Künste und die Bedeutung Münchens als Residenz und als Stadt der Kunst zu demonstrieren. In idealer Weise geeignet erschien Semper in diesem Zusammenhang ein Standort am stadtauswärtigen Isarufer (vgl. IfT_FaB_043, IfT_FaB_047, IfT_FaB_049), ungünstig hingegen das Terrain der seinerzeit noch bestehenden Hofgartenkaserne (vgl. Abb. 2a). Die Situationspläne zu Erstgenanntem veranschaulichen die mit dem Projekt einhergehenden Optionen für eine teilweise Neuordnung der St.-Anna-Vorstadt durch eine neu anzulegende Prachtstraße, die in eine Brücken– sowie eine vielteilige Rampen- und Treppenanlage vor dem Festtheater münden sollte.
Vom Etablissement Kroll zur Neuen Königlichen Oper
Das Etablissement Kroll mit seinem Sommergarten ist ein prominentes Beispiel für den im 19. Jahrhundert in vielen europäischen Städten anzutreffenden Typus multifunktionaler Gebäude, die dem Publikum ein breites Spektrum an Möglichkeiten des Zeitvertreibs boten. Sie kombinierten dabei in selbstverständlicher Weise Genres und Formate, für die man die trennenden Kategorien „unterhaltend“ und „ernst“ anzuwenden gewohnt ist. Dazu gehörten bei Kroll über die Jahrzehnte auch Theater- und Opernaufführungen. Nachdem das Etablissement 1894 in das Eigentum des Brauereibesitzers Julius Bötzow übergegangen war, wurde ein grundlegender Umbau zu einem nicht zuletzt technisch gut ausgestatteten Theater in Angriff genommen, das in der Folge von der Krone erworben wurde. – Im Nachlass Brandt wird der Umbau durch eine Reihe technischer Zeichnungen greifbar, die zum einen die Einrichtung der Bühne, des Orchestergrabens und des Zuschauerraums im Kontext der Gesamtanlage und zum anderen Details der Elektrifizierung nachvollziehbar machen.
Ein zweiter Materialbestand zu Kroll betrifft das problembehaftete, gleichwohl theater- wie technikgeschichtlich wegweisende Fortuny-System: Ab 1906 wurde bei Kroll in mehreren Etappen das von Mariano Fortuny konzipierte und wesentlich in Kooperation mit der A.E.G. sowie mit Fritz Brandt realisierte Projekt einer spezifischen Bühnenbeleuchtung unter Benutzung eines Kuppelhorizonts installiert, das schließlich im Sommer 1909 bei verschiedenen Opern- und Ballettproduktionen, darunter einer Einstudierung von Richard Wagners Tristan und Isolde unter der Leitung von Felix Mottl, zum Einsatz kam.4
Der Kaiser als „Erbauer“: das Projekt eines neuen Königlichen Opernhauses in Berlin
Es waren Fragen der Platzkapazität, moderner Sicherheitsstandards und nicht zuletzt der Repräsentation von Macht, die in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts zum Vorhaben eines Neubaus der Königlichen Oper in Berlin führten. Als charakteristisch für die etwa zehn Jahre andauernde Planungsphase, die in einer Reihe von Architektenwettbewerben mit äußerst prominenten Teilnehmern gipfelte, darf gelten, dass der erste mit Entwürfen beauftragte Architekt ebenso wie der letztlich mit der Realisierung des Projekts betraute Baumeister gleichsam Setzungen des Kaisers waren: Felix Genzmer war durch Arbeiten am Neuen Königlichen Hoftheater Wiesbaden und am Berliner Königlichen Schauspielhaus aufs Engste mit dem Kaiserhaus verbunden, Ludwig Hoffmann war Stadtbaurat in Berlin und Mitglied der Preußischen Akademie des Bauwesens. Genzmers erste Entwürfe aus dem Jahr 1906 sahen noch den Opernplatz als Standort für das neue Haus vor, Hoffmanns detailliert ausgearbeitete Planungen aus den Jahren 1913/14 bezogen sich dann auf den mittlerweile dafür bestimmten Königsplatz.5 Während Genzmer auch am ersten der Architektenwettbewerbe (1910) teilnahm,6 erklärte sich Hoffmann erst 1913 nach wiederholter Aufforderung zur Mitarbeit an dem Projekt bereit. – Der Nachlass Brandt umfasst unter anderem eine größere Anzahl technischer Zeichnungen zum Projektstand von 1913/14 (Hauptgebäude und Magazin), mit dem das Vorhaben kriegsbedingt sein Ende fand. Von besonderem Interesse ist sodann eine Serie von detaillierten Zeichnungen Fritz Brandts (Grundrisse, Längs- und Querschnitte, teils mit eingezeichneten Figuren), die in Übereinstimmung mit den (als solche nicht erhaltenen) ersten Entwürfen Genzmers auf 1906 datiert sind, ganz offensichtlich aber bereits vom Königsplatz und nicht mehr vom Opernplatz als Standort des neuen Opernhauses ausgingen (vgl. Abb. 5b).
Ungeachtet der Tatsache, dass sie überwiegend unrealisiert blieben, repräsentieren die vier hier vorgestellten Bauten in je spezifischer Weise maßgebliche Tendenzen der Einrichtung und der Nutzung von Theaterräumen im 19. und frühen 20. Jahrhundert: Sie zeigen die bis in den Ersten Weltkrieg hinein in Deutschland anhaltende Relevanz von Herrscherpersönlichkeiten für den Bau und den Unterhalt von Bühnen, während zugleich privates Unternehmertum einerseits und Kommunen andererseits als Träger von Theater in den Vordergrund traten. Ihre Architektur macht fassbar, wie neben den Historismus alternative Stile und Bauweisen traten, die auf technischen Innovationen basierten, Reformkonzepten im Funktionalen geschuldet waren oder auf moderne Anforderungen hinsichtlich Sicherheitsstandards reagierten. Die vier Projekte illustrieren zudem beispielhaft, inwieweit Theater als raumstrukturierende Bauaufgabe in den immens angewachsenen, der mittelalterlichen Begrenzungen entledigten Städten begriffen wurde.
Weiterführende Literatur und Materialien:
Bühnenbeleuchtung System Fortuny. Berlin: Beleuchtung System Fortuny G.m.b.H. / Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, [o. J.].
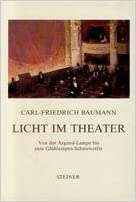
Baumann, Carl-Friedrich. Licht im Theater. Von der Argand-Lampe bis zum Glühlampen-Scheinwerfer. Stuttgart: Steiner, 1988.
Döhl, Dörte. Ludwig Hoffmann. Bauen für Berlin 1896–1924. Tübingen: Wasmuth, 2004.
Habel, Heinrich. „Die Idee eines Festspielhauses.“ In: Die Richard Wagner-Bühne König Ludwigs II. München Bayreuth, hrsg. v. Detta und Michael Petzet, 297–316, Tafelteil: Abb. 735–765. München: Prestel, 1970.
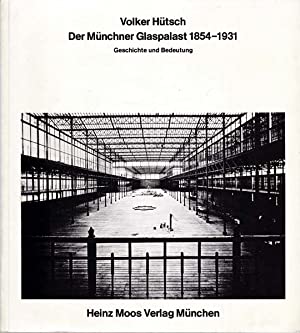
Hütsch, Volker. Der Münchner Glaspalast 1854–1931. Geschichte und Bedeutung, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin: Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften, 1985.
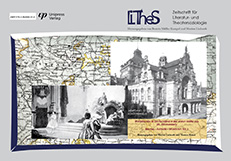
Reichardt, Hans J. … bei Kroll 1844 bis 1957. Etablissement, Ausstellungen, Theater, Konzerte, Oper, Reichstag, Gartenlokal. Berlin: TRANSIT, 1988.
Seidel, Paul (Hrsg.). Der Kaiser und die Kunst. Berlin: Reichsdruckerei, 1907.
Steiert, Thomas. „‚Durch das Medium dieser Stadt verbinden wir die großen Kunstwerke der Menschheit mit dem Leben.‘ Zum Stadtbezug der Salzburger Festspiele.“ In: Räume der Stadt. Von der Antike bis heute, hrsg. v. Cornelia Jöchner, 305–15. Berlin: Reimer, 2008.











