Bis heute ist die historische Beziehung von Theater, Technik und Industrie wenig untersucht. Die einflussreichsten Quellen stellen die selbstverfassten Geschichten von Bühnentechnikern und Industriebetrieben dar, die jedoch kaum selbst konsequent in ihrem historischen Kontext verortet werden. Neben den Selbsthistoriografien der Bühnentechnik, kann das umfassende Plan- und Zeichenmaterial im Nachlass der Bühnentechniker-Familie Brandt nun objektorientiert als kommunikative Schnittfläche von Theater(technik) und Industrie und als Niederschlag einer bühnentechnischen Wissensökonomie befragt werden: Welche Beziehungen zwischen Theater und Industrie lassen sich über die wirtschaftlichen hinaus für die Wissensökonomien der Bühnentechnik und die ästhetischen Ökonomien des Theaters anhand von Quellen der bühnentechnischen Praxis beobachten?
Während der bühnentechnische Diskurs am Anfang des 20. Jahrhunderts den Einfluss der Industrialisierung meist ab den 1880er Jahren mit dem Aufkommen der großen, eisernen Bühneneinrichtungen, Schiebe-, Dreh- und Podienbühnen geltend machte,1 lohnt ein spezifischer Blick auf die frühe Beziehung zwischen Theater und Industrie bis in die Ausläufer der Sattelzeit. So berichtet der Spezial-Katalog der Berliner Gewerbeausstellung aus dem Jahr 1896, dass die erste Maschinenwerkstatt Berlins bereits um das Jahr 1804 nicht nur große Schlosserarbeiten für öffentliche Bauten, sondern auch die Maschinerien für die königlichen Schauspiele fertigte. Der Gründer Caspar Hummel verknüpfte damit Theater und Maschinenbau gleichsam vom Beginn der deutschen Industrialisierung an. Die nachfolgenden Eisengießereien und Maschinenbaubetriebe setzten die Verbindung in ausgesprochen spezialisierten Abteilungen fort. Ein situierender Blick auf die im Brandt-Nachlass überlieferten Theaterpläne und bühnentechnischen Zeichnungen schlägt erste historiografische Ansatzpunkte für dieses frühe Theater der Industrie vor.
Gallerie
Grundsätzlich teilen sich die zahlreichen Pläne und Pausen der Sammlung in Bauzeichnungen für die theatertechnische Einrichtung und technische Detailzeichnungen auf. Der Großteil der mehrheitlich zwischen Vormärz und dem ersten Weltkrieg entstandenen Pläne entfällt dabei auf die Einrichtung des leeren Bühnenhauses mit Bühne, Ober- und Untermaschinerie, die zumeist in Bühnengrundriss, Quer- und Längsschnitt dargestellt wird. Die maßstäblichen, gelegentlich nach Baustoff kolorierten Zeichnungen geben Aufschluss über den Materialbedarf der Einrichtungen und lassen bspw. zu bestellende Seilmeter oder Holzlängen unmittelbar aus den Plänen abnehmen (vgl. Abb. 1). Darüber hinaus dokumentieren sie die bauliche Anlage für die entsprechenden Behörden. So finden sich u.a. auf Carl Brandts Grundriss, Quer– und Längsschnitt für das Altenburger Hoftheater die Stempel der herzoglich-ministerialen Finanzabteilung vom November 1869 (vgl. Abb. 2), auf den Schnitten für das Alberttheater in Dresden die Unterschrift des „Directoriums des Actienvereins für das Theater zu Neu und Antonstadt Dresden“ aus dem August 1871 und auch die Schnitte der Ober- und Untermaschinerie des Stadttheaters Düsseldorf waren als Vertragsdokumente vom 13. Juli 1875 paraphiert.
Abb. 1: Kolorierter Quer- und Längsschnitt des Schauspielhauses Köln von Carl Brandt, 1862. Theaterhistorische Sammlungen, Freie Universität Berlin, Signatur IfT_FaB_715 und IfT_FaB_716.
Sowohl im Fall von höfischen als auch bei privaten, bzw. bürgerlichen Aufträgen wurde den verantwortlichen Stellen also, wie heute, Planzeichnungen der bühnentechnischen Einrichtung zur Genehmigung und baulichen Dokumentation vorgelegt.
Inwiefern die Pläne auch zur (familien)internen Dokumentation von Projekten aufbewahrt wurden, müsste systematisch und im Vergleich mit anderen bühnentechnischen Traditionen technischer Zeichnung eruiert werden. Die Planungspraxis der bühnentechnischen Einrichtung bleibt für den wesentlichen Sammlungskorpus ähnlich und lässt zumindest für die Familie Brandt auf ein gängiges Vorgehen schließen: Das Architektenbüro übersendet Pläne der baulichen Gesamtanlage, die Maschinerie wird maßstäblich in Grundriss und Schnitten entworfen sowie den für den Bau verantwortlichen Stellen vorgelegt und schließlich werden Detaillösungen in einzelnen technischen Zeichnungen gestaltet.
Neben den konventionalisierten Einrichtungszeichnungen schlägt sich in den technischen Zeichnungen die rasante Entwicklung des Eisen- und Maschinenbaus nieder. Die Zeichnungen stehen in enger Beziehung zu Standards, die in den im 19. Jahrhundert entstehenden Technikwissenschaften erarbeitet und durchgesetzt wurden. Die von Wolfgang König vorgeschlagenen „Typen“ der Konstruktionspraxis bieten einschlägige Vergleichspunkte für die Bühnentechnik und sollen hier als ein situierender Zugriff auf die Sammlung rekapituliert werden.3 Im Wesentlichen sieht König die Typologie durch das Verhältnis von Konstruktion und Fertigung, die entsprechenden Mittel der Kommunikation zwischen ihnen, die Hilfsmittel des Konstruierens – zeichnerische Hilfsmittel, Bücher, Normalien etc. – sowie Ausbildung und berufliche Erfahrung bestimmt.4 Innerhalb einer deutschen bühnentechnischen Konstruktionskultur lassen sich die frühen Konstruktionen von Carl und seinem Bruder Fritz Brandt auf der Schwelle der „Meister“- und „Erfinderkonstruktion“ zur „Konstrukteurskonstruktion“ verorten. D.h. die Detail-Entwürfe der Brandt-Brüder und der fertigenden Firmen werden, der maschinenbaulichen Entwicklung stets um einige Jahre nachgelagert, bis in die 1880er Jahre zumeist in maßstäblichen Zeichnungen kodifiziert, die auf ein wenig formalisiertes und historisch schwer zu bestimmendes Zusammenwirken von entwerfendem Maschineriedirektor und fertigendem Meister verweisen, oder der Fertigung der Bühnenmaschinerie zunächst noch einen mehr oder weniger großen Freiraum bei der Gestaltung der technischen Produkte erlaubte. Die Maschinen waren Einzelanfertigungen, die vom Maschinisten technisch gestaltet und im Fertigungsprozess auskonstruiert wurden. Häufig wurde mit Bleistift skizziert, mit Feder und Tusche ins Reine gezeichnet und die relevanten Materialien farblich gekennzeichnet, allerdings lässt sich kein eindeutig standardisiertes Vorgehen erkennen. Beispiele sind nur grob bemaßten Zeichnungen, wie bspw. für eine „Vorrichtung zum Auf- und Niederwinden der Coulissen für das Königliche Opernhaus“ (vgl. Abb. 3) der Maschinenfabrik Möller & Blum. Gerade durch eine nicht bis ins Detail geregelte Wissensökonomie zwischen Gestaltung und Fertigung könnte der erfinderisch-konstruktive Anteil der Industrie an der Entwicklung von Theatermaschinerien als relativ hoch bewertet werden.
Mit der Verarbeitungsqualität von Eisen nimmt auch dessen Verwendung in der Bühnentechnik stetig zu. Da Bauteile und Maschinen in spezialisierten Fabriken gefertigt werden müssen, entwickelt sich die Detailzeichnung zum zentralen Kommunikationsmittel zwischen Entwurf und Fertigung. Im Gegensatz zur schwarz-weißen Werkstattzeichnung noch koloriert, aber feiner bemaßt und kommentiert, sind einige technische Zeichnungen von Versenkungen Fritz Brandts aus dem Jahr 1886, die zudem mit Plankopf und detaillierteren Schnittangaben spezifiziert sind.
Die kommunikative, ja mobile Funktion der Zeichnung macht auch der regelmäßig verwendete Stempel Fritz Brandts deutlich (vgl. Abb. 4a und 4b), der die Pläne als gesetzlich geschütztes, geistiges Eigentum auszeichnet. Die Ausdifferenzierung des maschinenbaulichen Wissens, in der die technische Gestaltung, wie Erfinden und Entwickeln, die Konstruktion und die Fertigung organisatorisch und räumlich auseinandertritt, schlägt sich in den technischen Zeichnungen in der Sammlung Brandt nieder. Ab den 1890er Jahren dokumentieren die steigende Anzahl von Blaupausen sowie Schriftstücke die zunehmende Konstruktionskompetenz der beauftragten Firmen, die König dem Typ der ausgeprägten „Konstrukteurskonstruktion“ zuordnet. Hillerscheidt & Kasbaum ist eine der Firmen, von der auskonstruierte, bemaßte sowie nummerierte Werkstattzeichnungen mit zu fertigender Stückzahl überliefert sind (Vgl. Abb. 5a und 5b). Auch ein Plan des Bauunternehmens Heilmann und Littmann für Gitterträger im Hoftheater Weimar, der nahezu jedes fertigungsrelevante Maß der Eisenkonstruktion ausweist, verdeutlicht das differenzierte und in der Zeichnung materialisierte Konstruktionswissen der Industrie (Vgl. Abb. 5c.)
Der bühnentechnische Erfinder erscheint hier mehr und mehr als fachkundiger Auftraggeber, der den Auftrags- und Produktaustausch zwischen theaterspezifischer Einrichtung und Einzelkonstruktion der Maschinen durch ein gutes Netzwerk häufig theaternaher Fertigungsstätten disponiert. Die eigene Zeichenkompetenz schien währenddessen aufrechterhalten worden zu sein, wurde aber nun mehr im Sinne von Projektzeichnungen eingesetzt, die fachfremden Auftraggebern die technischen Lösungen vereinfacht und ansprechend koloriert nahebringen.
Mit der „Firmenkonstruktion“ setzt nach Königs Typologie schließlich ein neues Kapitel der Konstruktionskultur ein, das sich unter dem Eindruck der Rationalisierungsbewegung um einen erneuten Bezug von Konstruktion und Fertigung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten bemühte. Beispiel für den Einfluss dieses Rationalitätsdiskurses auf die Bühnentechnik sind in dieser Hinsicht die Bestrebungen Friedrich Kranichs, Sohn vom Brandt-Schüler Friedrich Kranich d. Ä., der 1929 im ersten umfassenden Handbuch der Bühnentechnik das Wirtschaftlichkeitsparadigma als Grundformel der Bühnentechnik fest verankert.5 Kranich begreift die Industrie, der soeben vorgestellten Differenzierung entsprechend, nunmehr als eigenständiges Wissensfeld der ausführenden Fertigung.6 Nach dem Erfinder und dem Konstrukteur tritt der Betriebsingenieur auf den Plan, der sich mit dem ersten Weltkrieg als arbeitsorganisatorische und betriebsvorbereitende Kompetenz zu profilieren beginnt.
Für die Berufsgruppe der bühnentechnischen Vorstände, die die sich konsolidierende Ingenieursausbildung bis ca. 1900 mehrheitlich als unabgeschlossene Vorbildung für den praktischen Bühnenbetrieb nutzten, hatte die in den technischen Zeichnungen dokumentierte Veränderung der Wissensökonomie deutliche Auswirkungen: Ein Erfindungswissen in Bezug auf bekannte Inszenierungsprobleme und ikonische Augenblicke, wie bspw. spezifische Naturdarstellungen (Wasser, Donner, Feuer etc.), Schiffbrüche (Der fliegende Holländer, L’Africaine) oder die Schwimmbewegungen der Rheintöchter in Wagners Rheingold, konnte noch in die ästhetische Ökonomie des Theaters integriert werden: Ein einigermaßen homogenes und kenntnisreiches Publikum war in der Lage, die technischen Gestaltungsleistungen zu erkennen und entsprechend ihrer Wirkung vergleichend zu bewerten. Dagegen ließ sich, so scheint es, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmende Konstruktions- und Betriebswissen eher als Expertenwissen in den entstehenden Fachorganen zirkulieren.7 Für das Theaterpublikum konnten die technisch-logistischen Systeme der Betriebsingenieure, so ausgetüftelt sie auch sein mochten, nur noch in seltenen Fällen als das Werk eines einzelnen am Bühnengeschehen gestalterisch mitwirkenden Akteurs vermittelt werden. Zudem vereinte nun die Position des Regisseurs die Organisationsautorität über die ästhetische Ökonomie, also die Kombination und Gewichtung der vom Publikum anzuerkennenden, künstlerischen Werte.
Mit dem Übergang zu Standard und Typisierung begann sich das bühnentechnische Wissen zwischen Entwurf, Konstruktion, Fertigung und Normalien anders zu verteilen. Die historische Einwirkung dieser technischen Wissensökonomien auf die ästhetische Ökonomie des Theaters, jenseits von industriellem Fortschrittsdenken und ahistorischem Erfindergeist, bleibt näher zu untersuchen.
Weiterführende Literatur und Materialien:
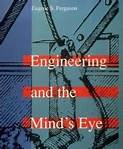
Ferguson, Eugene S. Engineering and the Mind’s Eye. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
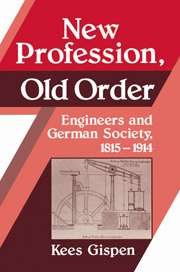
Gispen, Kees. New Profession, Old Order. Engineers and German Society, 1815-1914. [1989] New York: Cambridge University Press, 2009.
Kreuzer, Gundula. Curtain, Gong, Steam. Wagnerian Technologies of Nineteenth-Century Opera. Oakland, CA: University of California Press 2018.
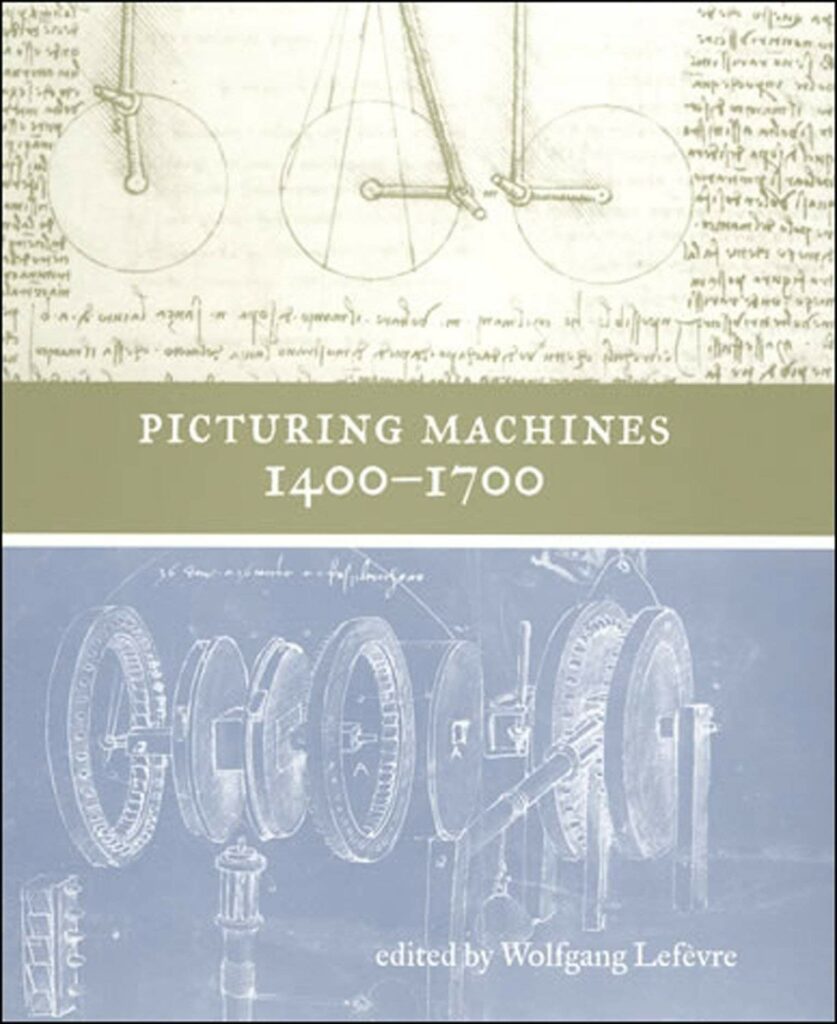
Lefèvre, Wolfgang (Hrsg.). Picturing Machines 1400-1700. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.
Long, Pamela O. Openess, Secrecy, Authorship. Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to the Renaissance. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
Lundgreen, Peter. Techniker in Preußen während der frühen Industrialisierung. Ausbildung und Berufsfeld einer entstehenden sozialen Gruppe. Berlin: Colloquium, 1975.
Nedoluha, Alois. Kulturgeschichte des technischen Zeichnens. Wien: Springer, 1960.
Otto, Ulf Das Theater der Elektrizität. Technologie und Spektakel im ausgehenden 19. Jahrhundert. Stuttgart: Metzler, 2020.
Paulitz, Tanja. Mann und Maschine. Eine genealogische Wissenssoziologie des Ingenieurs und der modernen Technikwissenschaften, 1850-1930. Bielefeld: transcript, 2012.
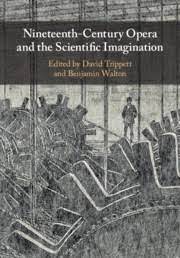
Trippett, David und Benjamin Walton (Hrsg.). Nineteenth-Century Opera and the Scientific Imagination. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.









